„Pädagogische Fachkräfte im Spannungsfeld der Wertekonflikte II“
 Wie schon zuvor in Dresden ging es in der zweiten Regionalkonferenz Ost am 4. Juni 2008 in Halle um die Entwicklung von Strategien im Umgang mit Wertekonflikten in Sachsen-Anhalt. Das Nachbarschaftszentrum „Pusteblume“ (Träger: SPI-Ost) in Halle war Kooperationspartner und zugleich Tagungsort. Diesmal konnten folgende Referenten und Referentinnen gewonnen werden: Norbert Blauig-Schaaf von „bildung: elementar“, Pascal Begrich von Miteinander e.V., und Annett Maiwald von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.
Wie schon zuvor in Dresden ging es in der zweiten Regionalkonferenz Ost am 4. Juni 2008 in Halle um die Entwicklung von Strategien im Umgang mit Wertekonflikten in Sachsen-Anhalt. Das Nachbarschaftszentrum „Pusteblume“ (Träger: SPI-Ost) in Halle war Kooperationspartner und zugleich Tagungsort. Diesmal konnten folgende Referenten und Referentinnen gewonnen werden: Norbert Blauig-Schaaf von „bildung: elementar“, Pascal Begrich von Miteinander e.V., und Annett Maiwald von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.
Werte sind nicht lehrbar, sondern nur lernbar
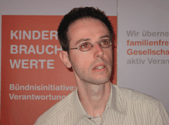 „Werte können nicht durch Institutionen vermittelt werden, d.h. auch nicht durch Kirchen und Kindergärten oder Schulen, sondern durch Menschen“, zitierte Norbert Blauig-Schaaf von „bildung: elementar“ Ilse Wehrmann. Kinder erfahren Werte nicht in gesonderten pädagogischen Veranstaltungen. Sie erleben sie in vielen verschiedenen Alltagszusammenhängen und in der Interaktion mit anderen Kindern und mit erwachsenen Bezugspersonen. Werte werden oftmals unbewusst an Kinder herangetragen. Deshalb ist es wichtig, dass insbesondere Erwachsene sich ihrer Wertvorstellungen/Wertbilder bewusst sind. Für Norbert Blauig-Schaaf gibt es für wertebewusste Bildung weder eine Methode noch eine pädagogische Zauberformel, sie wächst vielmehr aus einem wertschätzenden Umgang mit den Kindern heraus. Mit einer Wertevermittlung an Kinder korrigieren zu wollen, was die gesellschaftliche Moral der Erwachsenen hervorruft, kann Blauig-Schaaf zufolge nicht funktionieren. Werte sind nicht lehrbar, sondern nur lernbar. Diese Grundhaltung ist für ihn für eine wertebewusste Bildung in allen Kindertageseinrichtungen entscheidend.
„Werte können nicht durch Institutionen vermittelt werden, d.h. auch nicht durch Kirchen und Kindergärten oder Schulen, sondern durch Menschen“, zitierte Norbert Blauig-Schaaf von „bildung: elementar“ Ilse Wehrmann. Kinder erfahren Werte nicht in gesonderten pädagogischen Veranstaltungen. Sie erleben sie in vielen verschiedenen Alltagszusammenhängen und in der Interaktion mit anderen Kindern und mit erwachsenen Bezugspersonen. Werte werden oftmals unbewusst an Kinder herangetragen. Deshalb ist es wichtig, dass insbesondere Erwachsene sich ihrer Wertvorstellungen/Wertbilder bewusst sind. Für Norbert Blauig-Schaaf gibt es für wertebewusste Bildung weder eine Methode noch eine pädagogische Zauberformel, sie wächst vielmehr aus einem wertschätzenden Umgang mit den Kindern heraus. Mit einer Wertevermittlung an Kinder korrigieren zu wollen, was die gesellschaftliche Moral der Erwachsenen hervorruft, kann Blauig-Schaaf zufolge nicht funktionieren. Werte sind nicht lehrbar, sondern nur lernbar. Diese Grundhaltung ist für ihn für eine wertebewusste Bildung in allen Kindertageseinrichtungen entscheidend.
Praxisnahe Auseinandersetzung mit fremdenfeindlichen Einstellungen
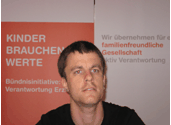 Pascal Begrich von Miteinander – Netzwerk für Demokratie und Weltoffenheit in Sachsen-Anhalt e.V. stellte die vier Schwerpunkte des Vereins kurz vor: Monitoring gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, Entwicklung von Handlungsstrategien, Sensibilisierung durch Fortbildungen und Beratung, und Prävention durch die Stärkung von Demokratie und Zivilgesellschaft. Der Verein hat Anfragen von Erzieher/innen erhalten, hauptsächlich aus strukturschwachen Regionen, die über den Umgang mit engagierten aber rechtsextremistischen Eltern eine Beratung suchten. Vor diesem Hintergrund ging Begrich der Frage nach, wie entsteht ein Klima von Fremdenfeindlichkeit? Dazu tragen bei: Die Abwesenheit von Zivilgesellschaft, ein autoritärer Identitätsdiskurs (DDR), hohe Zustimmungswerte zu menschenverachtenden Positionen sowie die Existenz einer rechtsextremen Jugendkultur. Bei einigen Jugendlichen herrscht eine Bedrohungskulisse in den Köpfen. Nach dem Ausländeranteil in ihrem Bundesland befragt, schätzen Schüler/innen in Sachsen-Anhalt es auf 40 bis 50 %, obwohl der tatsächliche Anteil lediglich 1,8 % beträgt. In der Jugendkultur ist zu beobachten, dass die Cliquenbildung immer früher anfängt (mit 12 – 13 Jahren). Anhand eines Szenenmodells erläuterte Begrich wie Jugendliche über Freunde vom äußeren Ring der Szenengänger/innen in den festen Kern einer rechten Clique hineinwachsen können. Die Herausforderung für die Pädagogik ist, es nicht so weit kommen zu lassen. Eine Möglichkeit wäre einen „Wettbewerb der Kulturen und Weltbildern“ zu unterstützen und damit eine demokratische vielfältige Erlebniswelt dem Rechtsextremismus entgegensetzen. Das fängt schon in frühen Jahren an, z.B. mit der Wahl des Spielzeugs und der Bilderbücher. Insbesondere sollten Demokratie und Vielfalt im Kindesalter erfahrbar gemacht werden und die Arbeit mit Eltern und Großeltern nicht vergessen werden – denn ohne sie kann Wertebildung nicht gelingen.
Pascal Begrich von Miteinander – Netzwerk für Demokratie und Weltoffenheit in Sachsen-Anhalt e.V. stellte die vier Schwerpunkte des Vereins kurz vor: Monitoring gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, Entwicklung von Handlungsstrategien, Sensibilisierung durch Fortbildungen und Beratung, und Prävention durch die Stärkung von Demokratie und Zivilgesellschaft. Der Verein hat Anfragen von Erzieher/innen erhalten, hauptsächlich aus strukturschwachen Regionen, die über den Umgang mit engagierten aber rechtsextremistischen Eltern eine Beratung suchten. Vor diesem Hintergrund ging Begrich der Frage nach, wie entsteht ein Klima von Fremdenfeindlichkeit? Dazu tragen bei: Die Abwesenheit von Zivilgesellschaft, ein autoritärer Identitätsdiskurs (DDR), hohe Zustimmungswerte zu menschenverachtenden Positionen sowie die Existenz einer rechtsextremen Jugendkultur. Bei einigen Jugendlichen herrscht eine Bedrohungskulisse in den Köpfen. Nach dem Ausländeranteil in ihrem Bundesland befragt, schätzen Schüler/innen in Sachsen-Anhalt es auf 40 bis 50 %, obwohl der tatsächliche Anteil lediglich 1,8 % beträgt. In der Jugendkultur ist zu beobachten, dass die Cliquenbildung immer früher anfängt (mit 12 – 13 Jahren). Anhand eines Szenenmodells erläuterte Begrich wie Jugendliche über Freunde vom äußeren Ring der Szenengänger/innen in den festen Kern einer rechten Clique hineinwachsen können. Die Herausforderung für die Pädagogik ist, es nicht so weit kommen zu lassen. Eine Möglichkeit wäre einen „Wettbewerb der Kulturen und Weltbildern“ zu unterstützen und damit eine demokratische vielfältige Erlebniswelt dem Rechtsextremismus entgegensetzen. Das fängt schon in frühen Jahren an, z.B. mit der Wahl des Spielzeugs und der Bilderbücher. Insbesondere sollten Demokratie und Vielfalt im Kindesalter erfahrbar gemacht werden und die Arbeit mit Eltern und Großeltern nicht vergessen werden – denn ohne sie kann Wertebildung nicht gelingen.
Ostdeutsche Erzieher/innen unter veränderten Verhältnissen
 In der ostdeutschen Kita-Landschaft, so Annett Maiwald von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, stehen sich zwei Konzepte gegenüber. Einerseits die Konzeption eines subjektiv motivierten, vom Kind aktiv initiierten und durchgehaltenen Bildungsprozesses, der sich im notwendigen Dialog mit den Erwachsenen entfaltet. Und andererseits das Konzept der Befähigung der Kinder zur regelgeleiteten Teilhabe an der Gesellschaft der Erwachsenen durch die Erzieherin. Eine Pädagogik, die das Durchsetzen von Regeln über die subjektiven Bildungsinteressen der Kinder stellt. Nachdem Maiwald auf die sozialistische Erziehung – die Eingliederung ins Kollektiv – und auf die angewendeten Methoden bei der staatlichen Kindererziehung einging, beschrieb sie auf sehr persönliche und anschauliche Weise anhand eines Beispieles „Aufräumen des Kinderzimmers“ das Spannungsverhältnis von Autonomie und Ordnung zwischen ihr selber und ihrem Sohn: Während für die Mutter unter den Spielsachen ein heilloses Durcheinander und keine Ordnung erkennbar war, unterwies sie ihr Sohn in die Funktionsweise der „kindlich-chaotischen“ Gebäude und Vorrichtungen. Bei einer Aufräumaktion „es wird aufgeräumt, was rausgekramt wurde und nur so rumliegt“ kann das Kind nur zur Erkenntnis gelangen, dass keine Achtung und kein Interesse an seinem/ihrem Produkten, den Resultaten seiner/ihrer kindlichen Eigentätigkeit, bestehen.
In der ostdeutschen Kita-Landschaft, so Annett Maiwald von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, stehen sich zwei Konzepte gegenüber. Einerseits die Konzeption eines subjektiv motivierten, vom Kind aktiv initiierten und durchgehaltenen Bildungsprozesses, der sich im notwendigen Dialog mit den Erwachsenen entfaltet. Und andererseits das Konzept der Befähigung der Kinder zur regelgeleiteten Teilhabe an der Gesellschaft der Erwachsenen durch die Erzieherin. Eine Pädagogik, die das Durchsetzen von Regeln über die subjektiven Bildungsinteressen der Kinder stellt. Nachdem Maiwald auf die sozialistische Erziehung – die Eingliederung ins Kollektiv – und auf die angewendeten Methoden bei der staatlichen Kindererziehung einging, beschrieb sie auf sehr persönliche und anschauliche Weise anhand eines Beispieles „Aufräumen des Kinderzimmers“ das Spannungsverhältnis von Autonomie und Ordnung zwischen ihr selber und ihrem Sohn: Während für die Mutter unter den Spielsachen ein heilloses Durcheinander und keine Ordnung erkennbar war, unterwies sie ihr Sohn in die Funktionsweise der „kindlich-chaotischen“ Gebäude und Vorrichtungen. Bei einer Aufräumaktion „es wird aufgeräumt, was rausgekramt wurde und nur so rumliegt“ kann das Kind nur zur Erkenntnis gelangen, dass keine Achtung und kein Interesse an seinem/ihrem Produkten, den Resultaten seiner/ihrer kindlichen Eigentätigkeit, bestehen.
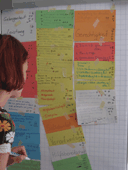 Maiwald schlägt vor, dass die Kitas sich von einer abgeforderten Ordnung bzw. von der kontrollierten, protokollierten Zeit und und von dem Einwand „nachher müssen sie es ja eh` können“ befreien. Für sie gilt es, die Heranziehung des Nachwuchses nicht nur als Vorbereitung und Einführung in die späteren erwachsenen Werte zu begreifen, sondern als Begleitung und Wertschätzung der für sich seienden Kinder. In den Kitas müssten bewusst gemachte Erfahrung und Vorbild vorherrschen und damit die Belehrung und Benennung von Werten ablösen, auf die meist die sogenannte Wertevermittlung hinausläuft.
Maiwald schlägt vor, dass die Kitas sich von einer abgeforderten Ordnung bzw. von der kontrollierten, protokollierten Zeit und und von dem Einwand „nachher müssen sie es ja eh` können“ befreien. Für sie gilt es, die Heranziehung des Nachwuchses nicht nur als Vorbereitung und Einführung in die späteren erwachsenen Werte zu begreifen, sondern als Begleitung und Wertschätzung der für sich seienden Kinder. In den Kitas müssten bewusst gemachte Erfahrung und Vorbild vorherrschen und damit die Belehrung und Benennung von Werten ablösen, auf die meist die sogenannte Wertevermittlung hinausläuft.











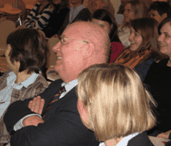

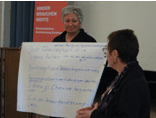

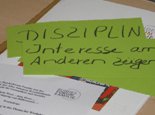

 „Werte können nicht vermittelt werden, sondern müssen von jedem Kind durch eigene Aktivit
„Werte können nicht vermittelt werden, sondern müssen von jedem Kind durch eigene Aktivit Für Preissing und Strätz ist Bildung ein aktiver Prozess, denn ein Kind entdecke, erforsche und gestalte seine Welt durch eigenwillige Tätigkeit mit allen Sinnen vom ersten Atemzug an. Für sie sei Bildung nicht von Wertebildung zu trennen. Werte könnten nicht vermittelt werden, betonte Preissing, sondern müssten von jedem Kind durch eigene Aktivität gebildet werden. In dieser Aktivität wollten Kinder wertgeschätzt werden und diese Wertschätzung sei die wichtigste Quelle, aus der die Kinder neue Energie für ihren weiteren Bildungsprozess zögen. Wertebildung sei ohne diese Wertschätzung nicht denkbar.
Für Preissing und Strätz ist Bildung ein aktiver Prozess, denn ein Kind entdecke, erforsche und gestalte seine Welt durch eigenwillige Tätigkeit mit allen Sinnen vom ersten Atemzug an. Für sie sei Bildung nicht von Wertebildung zu trennen. Werte könnten nicht vermittelt werden, betonte Preissing, sondern müssten von jedem Kind durch eigene Aktivität gebildet werden. In dieser Aktivität wollten Kinder wertgeschätzt werden und diese Wertschätzung sei die wichtigste Quelle, aus der die Kinder neue Energie für ihren weiteren Bildungsprozess zögen. Wertebildung sei ohne diese Wertschätzung nicht denkbar. Das Beobachten und Dokumentieren – eine jüngst noch mal sehr in die Bildungsdiskussion in den Tageseinrichtungen für Kinder eingebrachte Frage – stellen für Preissing und Strätz vielfältige Chancen dar, denn hier biete sich die Gelegenheit, in einen intensiven Dialog mit den Kindern zu treten. Hier werde deutlich, welchen Wert die betreffenden Aktivitäten für das jeweilige Kind und welchen Wert die Erzieherin ihr beigemessen hätten. Doch hiermit seien auch Risiken verbunden, denn vielerorts herrsche die Annahme, die eigenen Bewertungen seien außen vor zu lassen. Das Gegenteil sei der Fall. Kinder hätten ein Recht auf die Bewertungen der Erwachsenen und ein Recht, sich damit auseinanderzusetzen – nicht als Vorschrift, sondern als Feedback.
Das Beobachten und Dokumentieren – eine jüngst noch mal sehr in die Bildungsdiskussion in den Tageseinrichtungen für Kinder eingebrachte Frage – stellen für Preissing und Strätz vielfältige Chancen dar, denn hier biete sich die Gelegenheit, in einen intensiven Dialog mit den Kindern zu treten. Hier werde deutlich, welchen Wert die betreffenden Aktivitäten für das jeweilige Kind und welchen Wert die Erzieherin ihr beigemessen hätten. Doch hiermit seien auch Risiken verbunden, denn vielerorts herrsche die Annahme, die eigenen Bewertungen seien außen vor zu lassen. Das Gegenteil sei der Fall. Kinder hätten ein Recht auf die Bewertungen der Erwachsenen und ein Recht, sich damit auseinanderzusetzen – nicht als Vorschrift, sondern als Feedback.


 Arbeitsgemeinschaft für Kinder und Jugendhilfe (AGJ) am 20. Juni 2008 gemeinsam zum Fachforum „Zwischen Zeitgeist und Hilflosigkeit: Wertorientierte Erziehung in der Kinder- und Jugendhilfe“ ein. Impulse für die Diskussion gaben Prof. Dr. Sabine Andresen, Erziehungswissenschaftlerin an der Universität Bielefeld und Ulrike Thiel, Leiterin des Kinder- und Jugendhilfeverbundes Berlin-Süd der EJF Lazarus gAG.
Arbeitsgemeinschaft für Kinder und Jugendhilfe (AGJ) am 20. Juni 2008 gemeinsam zum Fachforum „Zwischen Zeitgeist und Hilflosigkeit: Wertorientierte Erziehung in der Kinder- und Jugendhilfe“ ein. Impulse für die Diskussion gaben Prof. Dr. Sabine Andresen, Erziehungswissenschaftlerin an der Universität Bielefeld und Ulrike Thiel, Leiterin des Kinder- und Jugendhilfeverbundes Berlin-Süd der EJF Lazarus gAG. in das Thema ein. Im Spiegel der öffentlich-medialen Wahrnehmung seien die Lebenslagen Kindheit und Jugend in steigendem Maße mit negativen Attributen verknüpft: übermäßiger Medienkonsum, mangelhaftes Gesundheitsbewusstsein, fehlendes Bildungsinteresse, Verantwortungslosigkeit, fehlender Gemeinsinn, von Gewaltanwendung geprägte Interaktionsmuster, defizitäre Regelaffinität u. v. m. Geradezu reflexartig ertöne hier der Ruf an die Erziehungs- und Bildungsinstanzen, die Vermittlung traditioneller Werte und Tugenden verstärkt in den Mittelpunkt ihrer Bemühungen zu stellen.
in das Thema ein. Im Spiegel der öffentlich-medialen Wahrnehmung seien die Lebenslagen Kindheit und Jugend in steigendem Maße mit negativen Attributen verknüpft: übermäßiger Medienkonsum, mangelhaftes Gesundheitsbewusstsein, fehlendes Bildungsinteresse, Verantwortungslosigkeit, fehlender Gemeinsinn, von Gewaltanwendung geprägte Interaktionsmuster, defizitäre Regelaffinität u. v. m. Geradezu reflexartig ertöne hier der Ruf an die Erziehungs- und Bildungsinstanzen, die Vermittlung traditioneller Werte und Tugenden verstärkt in den Mittelpunkt ihrer Bemühungen zu stellen. Auch Prof. Dr. Sabine Andresen wies den verkürzten Rückgriff auf ein nie da gewesenes „Goldenes Zeitalter“ zurück und erinnerte daran, dass der Wertediskurs auch ein Machtdiskurs sei. Es gehe um ein nicht einzulösendes, aber dennoch ersehntes „Versprechen nach Eindeutigkeit.“ Ferner nahm sie direkt zu Berhard Buebs Buch „Lob der Disziplin“ Stellung: „Bernhard Bueb sagt auch: Es müsse um die unhinterfragte Anerkennung von Autorität gehen, und damit habe ich ein Problem. Weil die unhinterfragte Anerkennung von Autorität kein einziges Erziehungsproblem tatsächlich löst. Er gibt keine Antwort auf konkrete Erziehungsfragen.“ Diese Position fand viel Zuspruch unter den zahlreichen Zuhörenden.
Auch Prof. Dr. Sabine Andresen wies den verkürzten Rückgriff auf ein nie da gewesenes „Goldenes Zeitalter“ zurück und erinnerte daran, dass der Wertediskurs auch ein Machtdiskurs sei. Es gehe um ein nicht einzulösendes, aber dennoch ersehntes „Versprechen nach Eindeutigkeit.“ Ferner nahm sie direkt zu Berhard Buebs Buch „Lob der Disziplin“ Stellung: „Bernhard Bueb sagt auch: Es müsse um die unhinterfragte Anerkennung von Autorität gehen, und damit habe ich ein Problem. Weil die unhinterfragte Anerkennung von Autorität kein einziges Erziehungsproblem tatsächlich löst. Er gibt keine Antwort auf konkrete Erziehungsfragen.“ Diese Position fand viel Zuspruch unter den zahlreichen Zuhörenden. 
 So einzigartig die Kinder selber sind, so bunt und vielseitig waren ihre Zeichnungen: Neben Mama, Papa, Großeltern und Geschwistern malten sie auch Personen des öffentlichen Lebens wie z.B. Martin Luther King, Polizistin, Lehrer, Engel oder Angela Merkel. Damit zeigt sich, wie genau Kinder ihre immer größer werdende Umwelt beobachten und sich an dem Vorgelebten orientieren.
So einzigartig die Kinder selber sind, so bunt und vielseitig waren ihre Zeichnungen: Neben Mama, Papa, Großeltern und Geschwistern malten sie auch Personen des öffentlichen Lebens wie z.B. Martin Luther King, Polizistin, Lehrer, Engel oder Angela Merkel. Damit zeigt sich, wie genau Kinder ihre immer größer werdende Umwelt beobachten und sich an dem Vorgelebten orientieren. Während die Kleinen zeichneten, wurden die Erwachsenen gebeten zu überlegen, was ihre Kinder von ihnen lernen. Nach der ersten Sprachlosigkeit, die meist mit solch einer Frage einhergeht, fingen die Eltern und Großeltern an, sich Gedanken über ihr Erziehungsverhalten zu machen. Das Zögern verwundert nicht, denn im Alltagsleben mit Kindern herrschen Routine und Gewohnheit. Das schafft natürlich die für Kinder nötige Stabilität, lässt aber wenig Platz für eine bewusste Reflexion des eigenen Handelns.
Während die Kleinen zeichneten, wurden die Erwachsenen gebeten zu überlegen, was ihre Kinder von ihnen lernen. Nach der ersten Sprachlosigkeit, die meist mit solch einer Frage einhergeht, fingen die Eltern und Großeltern an, sich Gedanken über ihr Erziehungsverhalten zu machen. Das Zögern verwundert nicht, denn im Alltagsleben mit Kindern herrschen Routine und Gewohnheit. Das schafft natürlich die für Kinder nötige Stabilität, lässt aber wenig Platz für eine bewusste Reflexion des eigenen Handelns.
