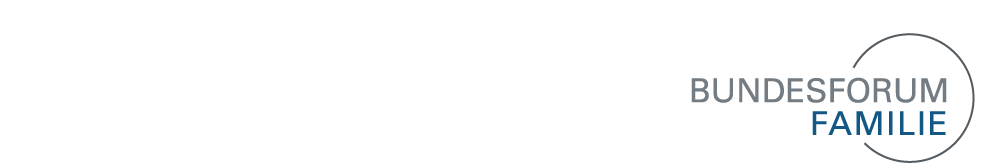Familien haben ein Recht auf eine intakte natürliche Umwelt. Nicht nur auf einer moralischen oder rechtsphilosophischen Ebene, sondern handfest in der Gesetzgebung festgeschrieben. Welche Gesetze befassen sich damit, was sind „ökologische Kinderrechte“ und werden diese auch umgesetzt? Wenn nicht, sind sie einklagbar? Auf der Suche nach Antworten auf diese Fragen versammelten sich knapp 40 Vertreter*innen aus den Mitgliedsorganisationen des Bundesforums Familie zu einem Online-Impulsworkshop.
Einführung
Projektkoordinatorin Elena Gußmann eröffnete die Runde und lenkte den Blick auf einige politische und gesetzliche Rahmen, in denen sich Berührungspunkte zu den ökologischen Lebensbedingungen von Familien finden lassen. Auf internationaler Ebene sei die UN Agenda 2030 und deren Ziele für eine nachhaltige Entwicklung, die bekannten SDGs (Sustainable Developement Goals) von Bedeutung, jedoch nicht rechtlich bindend. Zahlreiche Inhalte der 17 Ziele wiesen elementare Bezüge zu dem Lebensalltag von Familien auf, etwa die Zielbereiche Armut, Bildung, Geschlechtergerechtigkeit und Gesundheit. Die Bundesrepublik Deutschland habe zugesagt, die SDG im Rahmen der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, die sich derzeit in einem Weiterentwicklungsprozess befinde, umzusetzen.
Die UN-Kinderrechtskonvention sei hingegen rechtlich bindend. Insbesondere der Comment Nr. 26 (Version für Kinder) sei für die heutige Veranstaltung von Bedeutung. In diesem formuliere der UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes eine offizielle rechtliche Einschätzung und Handlungsanweisungen für Staaten im Kontext ökologischer Kinderrechte. Auf EU-Ebene sei wiederum die Europäische Charta der Rechte des Kindes in Artikel 24 (Rechte des Kindes) ein wichtiger Bezug. Hier würde zwar nicht das Recht auf intakte Umwelt und gutes Klima direkt aufgegriffen, wohl aber die Gewährleistung des Kindeswohls. Darin könne ein Argument für ökologische Lebensbedingungen gesehen werden. Auf nationaler Ebene verpflichte insbesondere Artikel 20a des Grundgesetzes den Staat. Zwar müssten die Maßnahmen zum Schutz der „natürlichen Lebensgrundlagen“ mit anderen Belangen abgewogen werden, jedoch betone nicht zuletzt das „Klima-Urteil“ des Bundesverfassungsgerichts von 2021 die Wichtigkeit von Maßnahmen als Teil einer „intertemporalen Freiheitssicherung“, die vor einer einseitigen Verlagerung der Lasten auf zukünftige Generationen schützen solle. Zudem formuliere auch §1 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes , dass die Jugendhilfe dazu beitragen solle „eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen“.
Insofern gebe es zwar zahlreiche politische und rechtliche Gesetze und Bereiche, die Familien und Kinder mit Klima in Verbindung bringen, jedoch verhandle kaum ein Gesetz Klima- und Kinderrechte explizit gemeinsam und rechtsverbindlich. Daher müsste, um beide Aspekte zu bedienen oft „über Bande gespielt“ werden. Eine Ausnahme sei der General Comment 26, in dem sich gleichermaßen soziale und ökologische Ansprüche befänden. Daher sei dieser und insbesondere dessen Umsetzung von besonderem Interesse – aus diesem Grund sei eine Auseinandersetzung mit dem General Comment 26 als erster Programmpunkt der Veranstaltung gesetzt worden.
Der General Comment 26 in der politischen Praxis
Nina Eschke (wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung Menschenrechtspolitik International) und Sophie Funke (wissenschaftliche Mitarbeiterin der Monitoring-Stelle UN-KRK) vom Deutschen Institut für Menschenrechte stellten vor, wie mit Berufung auf die UN-Kinderrechtskonvention aus der Perspektive der Kinder und Familien für mehr Klimaschutz argumentiert und auf die Verpflichtung der Staaten verwiesen werden könne.
Das Übereinkommen über die Rechte der Kinder wurde 1989 verfasst. Die UN-Kinderrechtskonvention schreibe hierin völkerrechtlich fest, dass Kinder auf gleicher Ebene wie Erwachsene wahrgenommen werden müssten.
Der Staat sei dazu verpflichtet, Kinder nicht an der Ausübung ihrer Rechte zu hindern (Achtungspflicht), Kinder vor Übergriffen und Ausbeutung durch Dritte zu schützen (Schutzpflicht) und die Umsetzung der Kinderrechte durch z.B. Infrastrukturmaßnahmen, soziale Leistungen oder Rechtsbehelfe zu gewährleisten (Gewährleistungspflicht). Der Staat stehe außerdem in der Pflicht, die Einhaltung der Rechte zu prüfen, unterstützt durch ein unabhängiges Monitoring durch Zivilgesellschaft und Wissenschaft. Darauf basierend formuliere der UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes konkrete Änderungshinweise. Auch wenn es sich dabei nur um Empfehlungen handele, betonte Sophie Funke, seien diese von hoher politischer Relevanz. Die allgemeinen Bemerkungen des General Comment seien hierfür als Interpretationshilfe anzusehen.
Der General Comment 26 sei im August 2023 durch den UN-Ausschuss veröffentlicht worden und schreibe fest: jedes Kind hat ein Recht auf eine saubere Umwelt. Entsprechend würden darin umwelt- und klimapolitische Maßnahmen empfohlen. An der Entstehung des General Comment 26 seien16.000 Kinder und Jugendliche aus 121 Staaten beteiligt gewesen. Sophie Funke wies darauf hin, dass der UN-Ausschuss sich nach weltweiten Protesten von Kindern und Jugendlichen des Themas angenommen habe. Dies zeige einmal mehr, wie wichtig es sei, Kinder als Akteure anzuerkennen.
Der General Comment 26 sei entlang der Grundprinzipien der UN-Kinderrechtskonvention aufgebaut – dazu gehöre beispielsweise das Recht, nicht diskriminiert zu werden, das Wohl des Kindes, das Recht auf Leben, Überleben und Entwicklung, das Recht gehört zu werden, der Zugang zu Information sowie das Recht auf Gesundheit. Die Bemerkungen führten jeweils aus, was dies in Bezug auf das Recht auf saubere, gesunde und nachhaltige Umwelt bedeute, z.B.: Kindern müsse der Zugang zu leicht verständlichen, wahrheitsgetreuen Informationen über Umwelt und Klima gewährleistet werden, ebenso wie der Zugang zu Justiz und Beschwerdeverfahren. Sophie Funke betonte, dass in zahlreichen Staaten noch ein innerstaatlicher Rechtsweg fehle, auch in Deutschland. Hier seien Kinder nach wie vor auf die Unterstützung Erwachsener angewiesen. Jedoch sei ein Individualbeschwerdeverfahren vor dem UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes möglich, wenn Kinder und Jugendliche ihre in der Kinderrechtskonvention oder in den beiden Fakultativprotokollen festgehaltenen Rechte verletzt sehen.
Nina Eschke lenkte die Aufmerksamkeit auf aktuelle politische Prozesse. Insbesondere aktuell, wo viele Maßnahmen im Rahmen des Bundes-Klimaanpassungsgesetzes (KAnG) diskutiert und beschlossen würden, gelte es genau hinzusehen, inwieweit die Maßnahmen die Kinderrechte gemäß der UN-KRK achten, schützen und gewährleisten. Es sei wichtig mitzudenken, inwiefern Klimaschutzmaßnahmen auch negative Auswirkungen auf Kinder und deren Rechte haben könnten. Dazu plane die Bundesregierung (Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz sowie das Bundesministerium für Arbeit und Soziales) den Aufbau eines „Sozialmonitoring Klimaschutz“. Dieses solle die sozialen Verteilungswirkungen von Klimaschutzmaßnahmen bereits im Vorfeld analysieren und Maßnahmen möglichst sozial und gerecht entwickeln. Dazu gebe es aktuell eine öffentliche Ausschreibung für die Konzeption des Monitorings. Nina Eschke verwies darauf, dass dies interessante Möglichkeiten biete, sich aktiv in den Prozess einzubringen. Im Zuge einer sozialen Klimaanpassung solle insbesondere der Schutz von Rechten von Menschen mit Behinderungen und Kindern mehr Aufmerksamkeit zukommen. Nina Eschke betonte, dass die sich aktuell im Entstehen befindliche „Vorsorgende Klimaanpassungsstrategie auf Bundesebene“ bei Festlegung von messbaren Zielen und Indikatoren und der Auswahl von Maßnahmen eine öffentliche Beteiligung vorsehe. Interessensvertretungen vulnerabler Gruppen und Verbände könnten sich hier gezielt einbringen. Die Etablierung einer „Vorsorgenden Klimaanpassungsstrategie Länder und Kommunen“ sei bis Januar 2027 vorgesehen. Auch hier eröffne sich die Möglichkeit, sich aktiv zu beteiligen.
Dr. Manuela Niehaus – „Klimaklagen – Einklagbarkeit von Klimaschutz und Wirksamkeit“
Dr. Manuela Niehaus ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Öffentliches Recht, für Öffentliches Wirtschaftsrecht und Klimaschutzrecht der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer. Sie stellte vor, was unter Klimaklagen national und international sowie auf völkerrechtlicher Ebene zu verstehen sei, machte auf die vielen „juristischen Fallstricke“ aufmerksam und zeigte auf, welche Ansatzpunkte besonders relevant für familienpolitische Belange sein könnten.
Unter dem Begriff Klimaklagen verberge sich eine Vielzahl an Formen des Klagerechts, die alle zur sogenannten strategischen Prozessführung gezählt würden. Klimaklagen, so Manuela Niehaus, vereine die Grundidee, die politische Ebene gefährde durch das Nichtstun die Zukunft und das Leben bzw. die Lebensqualität der Kläger*innen. Klimaklagen argumentierten vorrangig mit wissenschaftlichen Erkenntnissen (insbesondere den Berichten des IPCC) und seien häufig geprägt von einer Zusammenarbeit dreier Akteure: NGOs, die die Klagen anstoßen und unterstützen, oft jugendliche oder junge Kläger*innen und hochspezialisierte Anwält*innen. Gerichte würden hier nicht nur zu Orten der Rechtsprechung, sondern zu Foren des Protests und zur Möglichkeit, vulnerablen und oft nicht öffentlich sichtbaren Gruppen – etwa junge Menschen, oder Menschen im globalen Süden – in die Öffentlichkeit zu bringen. Eine erfolgreiche Klage fungiere dabei immer als Anstoß für weitere Klagen.
Umweltklagen zielten, so Manuela Niehaus, auf einen sozialen und/oder rechtlichen Wandel ab. Sie verfolgten in den konkreten Fällen verschiedene Ziele, richteten sich gegen verschiedene Akteure. Dementsprechend seien sie verschiedenen Rechtsbereichen zugeordnet und damit verschiedenen Zuständigkeiten. Um mit Klimaklagen erfolgreich zu sein, sei es daher zentral, die formalen Voraussetzungen zu kennen. Nur so könne vermieden werden, dass Klimaklagen allein aufgrund formaler „Nichtzuständigkeit“ bereits im Vorfeld abgelehnt würden.
Entscheidend für die Zuständigkeit der Gerichte sei, gegen wen geklagt werde und was erreicht werden solle: Klimaklagen, die sich gegen den Staat richteten, beträfen das öffentliche Recht. Dies liege in der Zuständigkeit der Verwaltungs-, Verfassungs- und internationalen Gerichte. Geklagt werden könne hier gegen einen Verwaltungsakt, ein Gesetz oder ein gesetzgeberisches bzw. politisches Unterlassen (zum Beispiel die fehlende Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen). Klimaklagen gegen den Staat könnten somit neben den Verwaltungsgerichten auch vor dem Bundesverfassungsgericht, dem Gericht der Europäischen Union, dem Europäischen Gerichtshof sowie vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verhandelt werden. Für Klagen gegen Unternehmen oder Einzelpersonen gelte das Zivilrecht. Zuständig dafür seien die Nationalen Zivilgerichte (Amtsgerichte, Landgerichte, Oberlandesgerichte sowie der Bundesgerichtshof). Zivilrechtliche Klagen könnten auf Unterlassung sowie auf Entschädigung und/oder Schadensersatz klagen. Unter das Strafrecht fielen Klagen, die die Legitimität von Protestformen erstreiten – beispielsweise im Kontext von Sitzblockaden sogenannter „Klimakleber*innen“. Diese würden überwiegend von NGOs genutzt und zielten auf öffentliche und politische Aufmerksamkeit.
Die meisten Klimaklagen, so Manuela Niehaus, stützen sich nicht auf das Recht auf gesunde Umwelt, da dies bislang nicht rechtsverbindlich anerkannt sei. Vielmehr würden klassische Menschenrechte „eingegrünt“. Mit dem sogenannten „greening“ würden Rechte, die per se keinen Umweltbezug haben, im Kontext von Umweltzerstörung und Klimawandel interpretiert. So werde z.B. aus dem Recht auf Familien- und Privatleben ein Recht auf eine intakte Umwelt abgeleitet, da es nur in dieser möglich sei, ein gutes Familienleben in Würde zu führen. Nur Klagen mit anthropozentrischer Perspektive seien erfolgsversprechend – d.h. die Natur selbst gelte nur insofern als schützenswert, als sie wichtig für den Menschen sei. Manuela Niehaus stellte eine Auswahl erfolgreicher Klimaklagen auf nationaler und internationaler Ebene vor, wie zum Beispiel die Klage der Klimasenior*innen vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte im Jahr 2024. Diese habe Erfolg gehabt, da sie die Schutzpflicht des Staates – in dem Fall der Schweiz – und damit dessen Kernaufgabe adressierte. Dem Staat blieben jedoch Ermessensspielräume, wie der Schutz gewährleistet werden könne. Es sei demnach kaum möglich, gegen eine konkrete klimaschädliche Maßnahme (z.B. Autobahnbau) zu klagen oder eine konkrete klimaschützende Maßnahme einzuklagen.
Anhand weiterer Beispiele erläuterte Manuela Niehaus die Problematik der Klagebefugnis. In Deutschland und in der EU seien sogenannte Popularklagen nicht erlaubt, die Selbstbetroffenheit der Kläger*innen müsse gegeben sein. Viele Klagen würden an diesem Punkt scheitern, denn Kläger*innen müssten darlegen, inwiefern gerade sie in ihren Rechten verletzt seien. Bei einer globalen Konstellation wie der Klimakrise, die letztendlich alle betrifft, sei dies besonders schwierig. Dass sich hier etwas bewegen müsse und aktuell auch bewege, zeige das Beispiel von „Carvalho gegen die EU“ im Jahr 2021. Die Klage sei aus dem Grund der nicht ausreichend dargelegten Betroffenheit als unzulässig abgewehrt worden. Im Nachspiel der Klage wurde die Aarhus-Konvention geändert, so dass neue Klagemöglichkeiten für Verbände eröffnet worden seien. Die Verbände müssten dabei nicht nachweisen, dass ihre Mitglieder persönlich mehr als andere betroffen sind, sondern nur, dass die Menschenrechte ihrer Mitglieder verletzt werden und dass sie als Organisationen qualifiziert sind, die Betreffenden zu repräsentieren. Vielleicht, so Manuela Niehaus abschließend, folge der Änderung der Aarhus-Konvention nun bald ein Schwung neuer Klimaklagen vor den EU Gerichten.
Diskussion
Die Voraussetzungen für Verbandsklagen waren Gegenstand der anschließenden Diskussion. Manuela Niehaus erklärte, dass es ein Umweltrechtsbehelfsgesetz gebe, in dessen Kontext Umweltrechtsverbände vor einem Verwaltungsgericht klagen könnten, wenn es eine entsprechende Umweltrechtslage gebe. Die neue Klagemöglichkeit vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte bezögen sich jedoch nicht explizit auf Umweltverbände, sondern allgemein auf Verbände, die sich entschließen, Klimaschutzrechte bzw. Menschenrechte im Hinblick auf Umwelt und Klima geltend zu machen – dies sei für familienpolitische Akteure also durchaus relevant. Inwiefern sich dieses neue Urteil auf die nationale Klimapolitik auswirke, werde sich noch zeigen.
Nachgefragt wurde auch die Dauer von Klageprozessen. Für diese sei entscheidend, so Manuela Niehaus, mit welcher Priorität die Klage behandelt und ob eine weitere Verfassungsbeschwerde angestrebt werde. Drei oder mehr Jahre seien durchaus möglich. Die Diskussionsrunde interessierte sich für sinnvolle Schritte eines strategischen Vorgehens. Als Bündnis zusammen eine Klage anzustreben sei vielversprechender als ein individuelles Vorgehen, es müsse jedoch berücksichtigt werden, ob die Klage im Hinblick der genannten Klägereigenschaften zulässig sei. Daher würden sich juristisch versierte NGOs oft erst im zweiten Schritt geeignete Kläger*innen suchen, die auf die angestrebten strategischen Prozesse passten.
Kritisch hinterfragt wurde, warum das Recht auf eine gesunde Umwelt noch kein Rechtsstand in Deutschland sei. Zwar stehe dies auch im Koalitionsvertrag, aber es zeichne sich bisher keine Veränderung ab. Hier könne eine Veränderung über Gerichte geschaffen werden. Es müsse auch verfolgt werden, was diesbezüglich auf europäischer Ebene entschieden werde, hier gebe es derzeit im Europäischen Gerichtshof (EUGH) interessante Entwicklungen. Diskutiert wurde in diesem Zuge auch das Konzept des „ökologischen Existenzminimums“, das von mehreren Akteuren im rechtspolitischen Rahmen des Art. 20a des Grundgesetzes eingefordert wird. Auf die Frage, weshalb die Forderung noch nicht viel Gehör fände, vermutete Manuela Niehaus, dass die Zustände wohl noch nicht apokalyptisch genug seien.